Berichte
1992-12-24 - Freiheiter Feuerwehr: Auf die Förderung angewiesen
Osteroder Kreis=Anzeiger vom 24.12.1992
Die Freiwillige Feuerwehr Freiheit zählt zu ersten Mal mehr als 500 Mitglieder
FREIHEIT (er) Als die Freiwillige Feuerwehr Freiheit im Mai dieses Jahres 115 Jahre alt wurde, gehörten ihr insgesamt 435 Mitglieder an. Jetzt am Jahresende sind es 530, davon sind 90 aktive und fast 440 fördernde Mitglieder. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Feuerwehr, daß man mehr als 500 Mitglieder hat.
Bedeutet es doch, daß etwa 23 Prozent der Einwohner der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes angehören. Darauf ist das Kommando der Wehr besonders stolz. Bei der Werbung neuer fördernder Mitglieder hat sich der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister, Waldemar Woschkeit, ganz besonders hervorgetan.
Er konnte allein 80 Freiheiter Bürger von der Notwendigkeit überzeugen, daß eine aktive und schlagkräftige Wehr heute mehr denn je auf die Unterstützung einer breiten Bevölkerungsschicht angewiesen ist. Gerade dadurch war es in den vergangenen Jahren möglich, erforderliche Ausrüstungsgegenstände anzuschaffen.
So konnten beispielsweise 1992 eine Motorsäge für rund 1000 Mark und zusätzliche Bekleidungsstücke für den Einsatz angeschafft werden. Die Fahrzeughalle wurde in Eigenleistung renoviert. Auch ari dem Kauf neuer Instrumente für den Feuerwehrmusikzug möchte man sich in diesem Jahr noch mit einem Zuschuß beteiligen.
Da jeder einzelne schnell einmal auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen sein könnte, sollten eigentlich alle verantwortungsbewußten Bürger ernsthaft erwägen, ob sie nicht die Männer und Frauen, die zu jeder Stunde einsatzbereit sind, wenn es darum geht, bei vielerlei Gefahren Hilfe zu leisten, durch einen geringen Jahresbeitrag in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Dieter Waldow, der vor kurzen als 500. Mitglied der Wehr beitrat, wurde mit einem kleinen Geschenk und einem Blumenstrauß geehrt.

Das Bild zeigt den stellvertretenden Freiheiter Ortsbrandmeister Rüdiger Peinemann, Dieter Waldow, der als 500. Mitglied der Wehr einen Blumenstrauß erhielt, Ortsbrandmeister Hermann Helbing und den ehemaligen stellvertretenden Ortsbrandmeister Waldemar Woschkeit (von links) während der Jahresversammlung. Foto:Schönfelder
Sonderposten-Markt von Einbrechern „abgefackelt"?
Harz-Kurier vom 27.07.1990:
Tornado-Preiswirbel" ging in einem Feuersturm unter
Osterode-Freiheit (in). Ein verheerender Großbrand hat in der Nacht zum Dienstag im Oste-roder Ortsteil Freiheit einen Sachschaden von mindestens 5 Millionen DM verursacht. Gegen 1 Uhr begannen aus einem ehemaligen Industriekomplex in der Hauptstraße helle Flammen zu lodern. Innerhalb von wenigen Stunden ging dann der dort ansässige Sonderposten-Markt ,,Tornado" (,,der Preiswirbel") in einem Feuersturm unter. Bei der Kripo Osterode, die noch in der Brandnacht zusammen mit dem Brandschutzsachverständigen des Landkreises Osterode die Ermittlungen aufnahm, geht man von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Eine technische Brandursache, so ein Kripo-Sprecher gegenüber unserer Zeitung, wird hingegen ausgeschlossen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen spricht vieles dafür, daß in der Nacht zum Dienstag zunächst in den Sonderposten-Markt eingebrochen wurde. Jedenfalls stellten die ermittelnden Beamten fest, daß die Tür zu einem Büro aufgeknackt worden war. In dem vom Feuer weitgehend verschonten Raum hatten die Täter die Wände und Einrichtungsgegenstände vollkommen mit Farbe beschmiert. Möglich, daß die Einbrecher aus Frust, nicht die passende Beute gefunden zu haben, dann Feuer legten und den Markt regelrecht abfackelten.
Feuerwehr und Polizei wurden kurz nach 1 Uhr über Notruf von dem Brand in Freiheit informiert. Wenige Minuten später heulten in der Innenstadt die Sirenen. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit mußten rasch erkennen, daß dieser Einsatz für sie allein einige Nummern zu groß war. Innerhalb von kurzer Zeit rückte Verstärkung aus Lerbach, Osterode und Förste an. Später kam dann auch noch die Wehr aus Bad Lauterberg mit ihrer Drehleiter hinzu. Insgesamt waren 14 Löschfahrzeuge und zwei große Drehleitern vor Ort, kämpften 120 Feuerwehrleute gegen die Feuersbrunst.
Vermutlich wurde der Brand in einem rückwärtigen Flachbau gleich hinter dem mehrstöckigen Hauptgebäude gelegt. Die Flammen fanden auf der rund 3.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche rasch genügend Nahrung: Lebensmittel, Kleinmöbel wie Sessel und Sonnenschirme, Autoradios und Grillbriketts verbrannten innerhalb von kürzester Zeit. Vasen und Schalen platzten, Dosen knallten. ,,Die Erbsensuppe spritzte bis zur Leiter hinauf' ', berichtete ein Feuerwehrmann. Innerhalb von einer halben Stunde bildete der gesamte Flachbau ein flammendes Inferno.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, bestand die Schwierigkeit beim Löschen vor allem darin, überhaupt erst einmal an den Brandherd in dem verbauten Komplex heranzukommen. Durch die vielen brennenden Kunststoffartikel bildete sich zudem starker Rauch mit giftigen Dämpfen, so daß die Wehrmänner nur mit Preßluftatmern an den Brandherd heranrücken konnten. Mehr als drei Stunden lang wurde aus allen verfügbaren Rohren Wasser in die Flammen gepumpt. Dann war das Feuer unter Kontrolle.
Der Flachbau war allerdings nicht mehr zu retten, doch dafür konnte zumindestens das mehrstöckige Hauptgebäude gehalten werden. Zwar züngelten auch hier die Flammen am Dachstuhl, doch größerer Feuerschaden entstand dadurch nicht. Allerdings wurde der in diesem Gebäude untergebrachte Schallplatten-Vertrieb Storz erheblich durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Viele der hier gelagerten Schallplatten, Musikkassetten und CDs dürften wohl nur noch als Sonderposten absetzbar sein. Außerdem wurde die Computeranlage des Vertriebes ein Raub der Flammen.

Freiheit· In der Nacht zum Dienstag wurde der Sonderpostenmarkt in der Hauptstraße vermutlich von Einbrechern in Brand gesteckt. Das ganze Ausmaß des Schadens Fotos: Lowin/Schönfeider
Hermann Gittner 1928
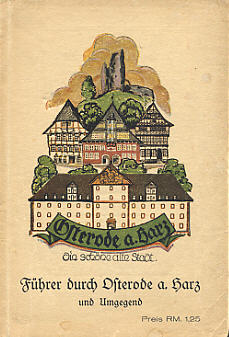
1928 schreibt Hermann Gittner in seinen Buch von 3 Fremdenheimen:
Alte Harzstraße 7:
- Pöhler
1 Zimmer, 1 Bett, Preis pro Bett 1,50
Verschiedenes: Garten, Laube
ohne elektrisches Licht
Baumhofstraße 6A:
- Busch
1 Zimmer, 1 Bett, Preis pro Bett 1,75 Elekr. Licht
Verschiedenes: Garten, Veranda
Hauptstraße 1:
Fr. Brüdern
4 Zimmer, 5 Bett, Preis pro Bett 2,-- Elekr. Licht Verschiedenes: Garten,
alle 3 Fremdenheime besitzen zu diesem Zeitpunkt weder Wasserklosett noch ein Bad
Erinnerunge aus alter Zeit - Von än alten Clastholer (Irschter Thäl.)
Clausthal, Pieper' schen Buchdruckerei (Bruno Reiche) 1907
Sonderabdruck aus den ,,Öffentlichen Anzeiger für den Harz" (von Hermann Ey) ,
Seite 66-67:
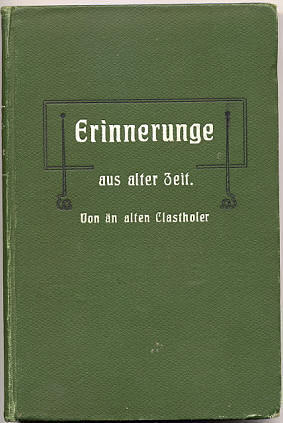 De Eseltreiwer von dr Freihät, die friher fast alle Tohk mit ihren Tropp Esel schwäre Trachten Kallig oder Korn von Osterod raufschleppten, sän jetz wull ahch ausgeschtorm; ich ho zum wenigsten käne meh gesahn. Disse vierbäning Languhren (dos häßt de Esel) waren äne ware Plohg, denn wenn se ihre Säck lus waren, su schtanden se mehrschtens vorn in dr Zahntnerschtroß, schtunnelang, weil de Harrn Eseitreiwer ahmsu lang drinne in Loden bän alten Walter sohzen un ihre Ziropsafterbrude un Kasschticker verzährten, wu natierlich ahch ä Kläner drzu genumme wur. Dr Hirt Fritz, dar ne immer äntrichtern mußte, hot se hunnert un tausend Mol zum Teifel gewinscht. Dr Hugo Walter schmiß ämol än raus, dar dickdrewesch un frach geworrn war un dar die Papsen links und rachts von' ne ehrlich verdient hatte. Denn dr Walter war ä forscher Karl un fackelte net lang. Dar Eseltreiwer wußte gar net, wie're dann huhng Tritt robgekumme war. Har kluhpschte nauf nohch dr Hausthier, dorfte sich ower net wieder blicken loßen. Un de Esels an Gamaschenschneider Bargmann sän Haus wußten vor Langerweil ahch nischt wätter als wie de Leit zu kujenieren, die in dr Zahntnergaß nein oder raus mußten, denn mit Hintenausschlahn war dos falsche Viehzeig immer bei dr Hand. Daß se wos ze frassen kriegen, ho ich net viel gesahn, un aus dissen Grund waren se wull ahch mehrschtens in dar rawiaten Schtimmung. Of dn Hämwahk kunnten se ju immer noch ämol rachts und links von dr Schorschee in dr Wies' giehn un sich soht frassen. Denn de Eseltreiwersch schliefen mannichsmol of ihren Gaul un sohngs net, un wachten oft ärscht auf, wenn dos alte Grauthier of dr Freihät all vor'n Schtall schtand. Wenn hinnewieder Äner runtergesegelt is, hots ju ahch kän Schoden wätter getan. Uhm of dr Osterederschtroß war ämol Äner su knille, daß 'r von sän bockbäning Esel immer wieder obgeschmissen wur, su viel wie se 'ne ahch naufhalfen, von dr rachten oder von dr linken Seit. Endlich hatt ne dar Esel ower mit sän Rezept su weit nichtern gemacht, daß ´r drnahm har laufen kunnte.
De Eseltreiwer von dr Freihät, die friher fast alle Tohk mit ihren Tropp Esel schwäre Trachten Kallig oder Korn von Osterod raufschleppten, sän jetz wull ahch ausgeschtorm; ich ho zum wenigsten käne meh gesahn. Disse vierbäning Languhren (dos häßt de Esel) waren äne ware Plohg, denn wenn se ihre Säck lus waren, su schtanden se mehrschtens vorn in dr Zahntnerschtroß, schtunnelang, weil de Harrn Eseitreiwer ahmsu lang drinne in Loden bän alten Walter sohzen un ihre Ziropsafterbrude un Kasschticker verzährten, wu natierlich ahch ä Kläner drzu genumme wur. Dr Hirt Fritz, dar ne immer äntrichtern mußte, hot se hunnert un tausend Mol zum Teifel gewinscht. Dr Hugo Walter schmiß ämol än raus, dar dickdrewesch un frach geworrn war un dar die Papsen links und rachts von' ne ehrlich verdient hatte. Denn dr Walter war ä forscher Karl un fackelte net lang. Dar Eseltreiwer wußte gar net, wie're dann huhng Tritt robgekumme war. Har kluhpschte nauf nohch dr Hausthier, dorfte sich ower net wieder blicken loßen. Un de Esels an Gamaschenschneider Bargmann sän Haus wußten vor Langerweil ahch nischt wätter als wie de Leit zu kujenieren, die in dr Zahntnergaß nein oder raus mußten, denn mit Hintenausschlahn war dos falsche Viehzeig immer bei dr Hand. Daß se wos ze frassen kriegen, ho ich net viel gesahn, un aus dissen Grund waren se wull ahch mehrschtens in dar rawiaten Schtimmung. Of dn Hämwahk kunnten se ju immer noch ämol rachts und links von dr Schorschee in dr Wies' giehn un sich soht frassen. Denn de Eseltreiwersch schliefen mannichsmol of ihren Gaul un sohngs net, un wachten oft ärscht auf, wenn dos alte Grauthier of dr Freihät all vor'n Schtall schtand. Wenn hinnewieder Äner runtergesegelt is, hots ju ahch kän Schoden wätter getan. Uhm of dr Osterederschtroß war ämol Äner su knille, daß 'r von sän bockbäning Esel immer wieder obgeschmissen wur, su viel wie se 'ne ahch naufhalfen, von dr rachten oder von dr linken Seit. Endlich hatt ne dar Esel ower mit sän Rezept su weit nichtern gemacht, daß ´r drnahm har laufen kunnte.
Ich gläb, de Clastholer han käne Thrane drhinterhar vergossen, wenn epper dis berihmte Eseltreiwer-lnschtitut ängegange sein sollte.
Nachrichten über die Gemeinde Freiheit (1897)
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1897
Über die Entstehung des Dorfes Freiheit bei Osterode a/Harz am Ausfluß des Lerbaches In die Söse gelegen, sich von der Osteroder Johannes=Vorstadt bis zum Walde im Tale des Lerbaches hinziehend, ist wenig bekannt. Wahrscheinlich ist es durch eine Ansiedlung am Fuße auf dem jetzigen Johannis=Kirchhof gelegenen alten Burg, die den Herzogen von Grubenhagen gehörte und von der gegenwärtig nur noch eine Turm steht, entstanden. Die Bewohner waren daher wohl zuerst Burgsassen. Später Hörige der dem Welfenhause angehörenden Herzoge von Grubenhagen. Am 4 April 1556 starb Herzog Phillip der Jüngere, mit welchem diese Linie des- Welfenhauses ausstarb. Das Land fiel zuerst an Heinrich Julius von Braunschweig, aber in dem Rechtsstreite, welcher sich zwischen ihm und den Lüneburgischen Herzögen erhob und der erst im Jahre 1617 sein Ende erreichte, blieb das Haus Luneburg=Celle Sieger. Bis in die Mitte dieses Jahrhunderts lagen auf den Reihehäusern sogenannte Herrendienste erst nach 1848 wurden dieselben abgelöst indem jede volle Reihestelle anstatt der Herrendienste jährlich 5 Taler bezahlen mußte. Dagegen blieben auf den Reiheställen noch die Verpflichtungen bei der Herstellung neuer Chausseen und ihrer Erhaltung Dienste leisten zu müssen. Diese kamen erst. In Wegfall, als der Wegeverband eingerichtet wurde.
Die Einwohner waren zum größten Teil Weber, Eimermacher und Eseltreiber. Die letzteren hatten dadurch ihren Erwerb, daß sie auf der alten Harzchaussee auf ihren Mauleseln das Korn von dem Kornmagazin in Osterode nach den Bergstädten Clausthal und Zellerfeld brachten. Diese Eseltreiberei hat ihr Ende gefunden zum Teil durch die Anlegung der Eisenbahn nach Clausthal=Zellerfeld, zum Teil durch die Anlegung weniger steilen Chaussee durch das Lerbachtal nach jenen Orten. Während früher 80 und mehr Maulesel in Freiheit gehalten wurden, gab es zuletzt nur noch 3, die auch im Jahre 1875 abgeschafft wurden.
Die Handweberei stand früher sehr in Blüte, so daß manche Leute es dadurch zum Wohlstand gebracht haben. Es gab 70 und mehr Webstühle.
Seit der Entstehung der Fabriken, welche auf mechanischen Webstühlen die Stoffe herstellen, ist die Handweberei sehr zurückgegangen. Jetzt sind nur noch 20 Webstühle vorhanden. Die Weber können nicht mit den Fabriken concurieren, sie verdienen daher jetzt nur einen geringen Tagelohn. Die Zeit scheint nicht mehr fern zu sein, daß die Handweberei vollständig der mechanischen Weberei weichen muß.
Auch die Eimermachereien, deren es früher mehrere gab, besonders 'hervorragend waren die Firmen Johann Georg Mackensen und H. Hühne, sind nach und nach eingegangen. Denn die Holzeimer wurden im Gebrauch, mehr und mehr durch die Blech= und Eisenblecheimer verdrängt. In dem nahen Osterode gibt es noch mehre, Eimermachereien, in denen Eimermacher aus Freiheit als Arbeiter tätig sind. Die selbständigen Eimermachereienin Freiheit sind seit 1890 eingegangen.
Es gab auch 4 Töpfereien im Orte, die einen ziemlich ausgedehnten Betrieb hatten. Dieselben sind jedoch schon seit 1867 eingegangen.
Die Gemeinde Freiheit zählt gegenwärtig rund 1300 Seelen. 116 Wohnhäuser sind vorhanden, darunter 6 Fabriken, nämlich 4 Wollwaren, 1 Zigarren und 1 Maschanenfabrik An sonstigen größeren Geschäften sind vorhanden: 1 Gastwirtschaft, 1 Kaufmannsgeschäft, 2 Tischlereien, 4 Bäckereien, mehrere Schneider, Schuster und andere kleine Handwerker, auch eine Schönfärberei und chemische Waschanstalt.
In früherer Zeit gehörten noch zu Freiheit verschiedene außerhalb der alten Stadtmauer von Osterode erbaute Häuser und Fabriken, nämlich 15 zerstreut liegende Häuser, darunter 2 Fabriken, nämlich die Bleiweißfabrik, Harzer Bleiwerke und die Deckenfabrik Eulenburg, ferner die Gipsbrennerei und Ziegelei Augustental, das Osteroder Realgymnasium die Destillation von Böhlke & Schimmler und das „Rote Haus", jetzt Berggarten genannt; ferner noch verschiedene Wohnhäuser am Dielenplan und in der Eisensteinstraße. Im Jahre 1884 wurden diese Häuser und Etablissements der Stadt Osterode einverleibt, wofür die Gemeinde Freiheit eine jährliche Rente von 1500 Mark von der Stadt Osterode erhält.
Durch die Entstehung und Weiterentwicklung der oben schon genannten Fabriken ist Freiheit zu einem ziemlich bedeutenden Industrieort geworden, und teilt alle Vorteile und Nachteile eines solcher. Es ist der Gesamtwohlstand der Gemeinde durch dieselben gehoben, aber an Stelle der früher selbständigen 'Weber sind jetzt Fabrikarbeiter getreten.
Über die Entwicklung der Textilindustrie ist folgendes zu verzeichnen: In der Gemeinde Freiheit wurde in ähnlicher Weise wie in der Nachbarstadt Osterode a/Harz schon im vorigen Jahrhundert die Fabrikation von Tuchen, halbwollenen Beiderwand, Leinen und Drall, meistens als Hausindustrie, lebhaft betrieben, doch kann man als Anfang des eigentlichen Fabrikbetriebes erst das Jahr 1827 bezeichnen. Von Anfang der dreißiger bis Mitte der sechziger Jahre, war ein entschiedener allmählich fortschreitender Aufschwung, namentlich in der Tuch=, Crating= und Deckenfabrikation zu verzeichnen.
Danach trat ein gewisser Stillstand und in den siebziger Jahren ein entschiedener Rückgang ein, sodaß in den achtziger Jahren einige Fabriken ihren Betrieb einstellen mußten. Mitte der achtziger Jahre gingen einige Fabriken in andere Hände über und ist seit der Zeit unverkennbarer Aufschwung zu verzeichnen, der bis heute angehalten hat. Die jetzt unter den Namen „Osteroder Wollgarn=Spinnerei G.m.B.H.“ existierende Fabrik wurde 1837—1838 von Koch & Greve zu dem Zwecke einer Tuchfabrik gebaut. Als solche bestand sie nur wenige Jahre und wurde bis zum Jahre 1853 darin Bleiweißfabrikation von dem Bankhause Gebrüder Horstmann in Celle betrieben, Durch Kauf ging sie ln die Hände von Hausmann & Hartmann über, die eine Spinnerei und Weberei von halbwollenen Waren einrichteten. Hartmann trat 1860 aus und Betrieb Hausmann bis' zum Jahre 1872 die Fabrik allein. Dann trat Hermann Köster ein und wurde nur Kunstwolle zu Webgarn verarbeitet. Hausmann trat sehr bald aus und beteiligte sich Anfang der achtziger Jahre F Wichehausen, welcher letztere Fabrik Im Jahre 1888 für alleinige Rechnung übernahm und sie in eine Aktiengesellschaft umwandelte, später in eine Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Heute sind 6 Assortimente Spinnerei mit 1500 Spindeln im Betriebe und werden nur Garne zu Webzwecken hergestellt.
Die frühere Oelmühle von Ludwig Rohrmann ging 1841 durch Kauf in die Hände der Gebrüder Dameral über, welche eine Tuch=, Decken Velourfabrikation einrichteten. Dieselben schafften 1859 den ersten mechanischen Webstuhl an und Anfang der sechziger Jahre wurde, da die Wasserkraft nicht mehr ausreichte, eine Dampfmaschine erbaut. Die späteren Inhaber der Firma reüssierten nicht und mußten 1882 ihre Zahlungen einstellen. 1884 erwarben im Konkurse von Allwörden & Badendiek das Grundstück und bauten eine vollständig neue Fabrik auf demselben die sich im Laufe der Jahre erweiterte, und heute, 170 Arbeiter beschäftigt, die einen Durchschnittslohn bei 10,5 stündiger Arbeitszeit in der Woche 11M. 56Pf .verdienen, jugendliche und weibliche Arbeiter mit eingerechnet. Es werden Loden, Flanelle, Moltongs, Cheviots gearbeitet circa 15000 Stück das Jahr auf 81 mechanischen Webstühlen. Im Betrieb ist vollständige Fabrikation von der rohen Wolle bis zum fertigen Stück, Wollwäscherei, Färberei, Spinnerei, Weberei, Appretur.
Die jetzige Fabrik von Otte Gebser in halbwollenen Kleiderstoffen mit 8 mechanischen Webstühlen war bis zum Jahre 1885 eine Buckskingfabrik, welche von der Firma W.A.Greve sen. betrieben wurde
Im Jahre 1856 errichtete J.G.Mackensen eine Fabrik von wollenen Schlaf= und Pferdedecken, die auch heute noch von einem Großsohn Georg Levin, mit einem kürzlich eingetretenen Herrn Siering, unter derselben Firma betrieben wird.
Die Weberei von halbwollenen Beiderwand auf Handstühlen, welche in den sechziger und siebziger Jahren noch sehr als Hausindustrie florierte, ist immer weiter zurückgegangen, da der Artikel immer mehr aus der Morde kommt, und sind jetzt noch 12 Stühle davon in Betriebe.
Die jetzige Zigarrenfabrik ist im Anfang der dreißiger-Jahre dieses Jahrhunderts als Brennerei erbaut, in welcher Kartoffelbranntwein gemacht wurde. Diese hat aber nur 10 Jahre bestanden, dann ist in dem Hause eine Färberei gewesen; dann hat dasselbe auch als Brennerei gedient. 1867 hat die Firma "König & Compagnie in Braunschweig gekauft und eine Zigarrenfabrik darin eingerichtet. Diese Fabrik ist jetzt im Baubegriffenen Schulhause am Lerbach abwärts benachbart, durch einen der Firma König u. Co. gehörenden Garten von demselben getrennt Die Zigarrenfabrik beschäftigt gegenwärtig etwa 30 Arbeiter, Männer und Frauen.
Die frühere alte Schule (No.69), von welcher in den Nachrichten über die Schule geredet wird, hat im Jahre 1845 Wilhelm Bauer gekauft und eine Maschinenbauerei darin eingerichtet, 1870 hat dieselbe Wilhelm Friedrichs gekauft, der dieselbe noch jetzt von seinen ältesten Sohn unterstützt, betreibt. derselbe hat zuerst mit 8 Mann den Betrieb geführt jetzt beschäftigt er 24 Arbeiter.
Die Gemeinde wird geführt vom Vorsteher Gärtner Windhausen, (geb. 4.April 1820 in Osterode) welcher seinem Amtsvorgänger. dem Leggemeister Giere im Jahre 1870 folgte. Er verwaltet noch jetzt (1897) nach 27jähriger Amtstätigkeit sein Amt in Rüstigkeit und Frische. Seit 1875 führt der Weber August Wildt die Rechnung der Orts=und Schulgemeinde zur großen Zufriedenheit der Gemeinde. Als Beigeordneter des Gemeindevorstehers fungiert der Eimermacher L. Plümer. Gemeindeausschuß=Mitglieder sind die Herrn v.Allwörden, O. Gebser, W. Friedrichs, A. Kallmeyer, H. Mävers, L. Merten, O. Garnatz, Fr. Lüer, Andreas Nothdurft. Nachtwächter und Gemeindediener ist Heinrich Borchers (Sohn des Webers Christian Borchers).
Die Ablosung der Gemeinde= Bau= und Brennholzberechtigung hat im Jahre 1881 begonnen. Für beide Berechtigungen hat die Gemeinde ein Kapital von 22280 Mark erhalten. Diese Summe ist bisher auf Hypothek ausgeliehen, wird jetzt aber zur Deckung der Kosten des gegenwärtigen Schulneubaues verwendet.
Die Gemeinheitsteilung und Verkoppelung der zu Freiheit gehörenden Ländereien ist seit 1896 vollendet. Die Vorteile dieses Verfahrens sind lediglich der sogenannten Realgemeinde zu Gute gekommen, während die politische Gemeinde dabei leer ausgegangen ist.
Das Vereinswesen hat Inder Gemeinde folgende Entwicklung genommenen: Im Jahre 1862 wurde der „Männergesangverein mit 25 Mitgliedern gegründet, derselbe zählt jetzt 125 Mitglieder und hält seine Übungen in Gasthaus von Burchhardt ab. Seit seiner Gründung hat die Leitung des Gesangvereins bis auf den heutigen Tag der Dirigent der –Osteroder Stadtkapelle Herr Klingebiel. 1872 ist die Freiheiter Schützengesellschaft gegründet, deren Statuten hierbei niedergelegt sind. Der größte Teil der Mitglieder gehört der Gemeinde Freiheit an, da jedoch die Gesellschaft eine Aktiengesellschaft ist, so gehören auch auswärtige Mitglieder derselben an, welch, sich einen Anteilschein für 15M erworben haben. Die Gesellschaft hält jährlich im Juli ein 8 tätiges Schützenfest ab, auf dem an der alten Harzchaussee schön gelegener Schützenplatze. Im Mai 1877 ist die freiwillige Feuerwehr gegründet. Es wurde eine Feuerspritze für 2100 aus der Fabrik von C.Metz & Comp. in Heidelberg angeschafft, für welche im selben Jahre das Spritzenhaus mit Turm erbaut wurde. Glücklicherweise hat die Feuerwehr bisher keine Gelegenheit gehabt in Freiheit selbst in Tätigkeit zu treten. Sie hat aber öfter auswärts, namentlich indem benachbarten Osterode Hilfe geleistet. Denn es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß seit dem Jahre 1848 in Freiheit kein Brand vorgekommen ist, während in Osterode fast kein Jahr vergeht, in welchem nicht mehrere Male ein größerer Brand vorkommt. 1883 wurde der Kriegerverein gegründet, welcher zuerst 71 Mitglieder zählte, während er jetzt aus 102 Mitgliedern besteht. 1888 wurde die Fahne des Vereins geweiht. Am 21. und 22.März 1897 feierte der Verein in großartiger Weise die 100 jährige Wiederkehr des Geburtstages des Hochseeligen Kaisers Wilhelm I. des Großen, wie solches in den beiliegenden Nummern des Allgemeinen Anzeigers des Näheren berichtet wird. Bei der Feier der 400 jährigen Wiederkehr des Geburtstages von Dr. Martin Luther wurde auf dem Schützenplatze eine Luthereiche gepflanzt und zwar ist es die Eiche, welche mehr nach dem Gebirge zusteht. Bei der Feier des 100 jährigen Geburtstages Kaiser Wilhelm I. des Großen, wurde auf dem Schützenplatz die Kaiser Wilhelm I. Gedächtniseiche gepflanzt. Sie steht in der Richtung nach dem Sösetale zu.
An sonstigen bemerkenswerten Ereignissen, die noch in der Erinnerung des gegenwärtigen Geschlechtes leben, wird noch Folgendes verzeichnet: Am 27. Juni 1861 war ein wolkenbruchartiger Reger, welche 2 Tage und 2 Nächte andauerte. Infolgedessen schwoll der Lerbach so hoch an, daß er den ganzen Ort überschwemmte. Bäume trieben herab, legten sich quer vor die Gebäude, so daß mehrere Ställe vollständig weggerissen wurden. Von Freiheit ab floß das Wasser durch die Johannisvorstadt. Wo es bei dem niedig gelegenen Gebäuden in die Fenster des unteren Stockwerkes floß. Menscherleben sind in Freiheit nicht zu beklagen gewesen. Schlimmer noch ist die Wasserflut der Söse gewesenen. Dieselbe hat auf dem linken Ufer die Promenade unterspült, die Mauer und die Bäume weggerissen Ein junger Mensch, hatte sich an das Ufer gestellt, um den Wasserfluten zuzusehen, als der Boden unter seinen Füßen weggerissen wurde, sodaß er selbst in die Flut stürzte und ertrank. Die Stadt Osterode ist durch diese. Wasserflut großer Schaden erwachsen, da sie unter großen Kostenaufwande die Ufer der Söse durch Mauerwerk wieder einfassen lassen mußte.
Am 28. Juli 1895 zwischen 11 und 12 Uhr nachts war. ein furchtbares Hagelwetter, mit orkanartigem Sturm über die hiesige Gegend hereingebrochen, während. gerade das Freiheiter Schützenfest gefeiert. wurde. Auf den Schützenplatze wurde das Karussell 6 Meter weit weggetragen und dabei umgestürzt; das Restaurationszelt, war abgedeckt, in zwei. Zelte schlug der Blitz ein, doch glücklicher Weise ohne zu zünden. Es waren zwar viele von den Festteilnehmern verwundet. Aber Menschenleben sind nicht verloren gegangen. Im Bremketale hatte der Sturm einen fruchtbaren Windbruch angerichtet, für 1,5 Millionen Mark Wald war durch den Sturm umgebrochen. Manche Bäume waren durch den Sturm rundum gewirbelt und vollständig zersplittert. Fast zwei Jahre haben die Aufräumungsarbeiten gedauert und es ist noch nicht alles Holz abgefahren.
Es erübrigt nun noch eine Übersicht über die Steuerverhältnisse der Gemeinde zu geben. Folgende Steuerbeiträge werden von der Gemeinde aufgebracht:
|
1) Staatseinkommensteuer
|
429 M
|
--
|
|
2) Ergänzungssteuer
|
683 M
|
60Pf
|
|
3) 45% Grundsteuer
|
84 M
|
65Pf
|
|
4) 45% Gebäudesteuer
|
596 M
|
11Pf.
|
|
5) 36% Gemeideeinkommensteuer
|
1498 M
|
04Pf.
|
|
6) 45% Gewerbesteuer
|
694 M
|
80Pf
|
|
7) Hundesteuer
|
116 M
|
--
|
|
8} Betriesteuer
|
20 M
|
--
|
|
9) Schulsteuer
|
3488 M
|
36Pf.
|
Vor zehn Jahren wurde nur die Hälfte der Steuern gezahlt, so sehr hat sich die Steuerkraft der Gemeinde gehoben.
Daß der Wohlstand der Gemeinde sich gehoben hat, ist auch den Einrichtungen für die allgemeine Volkswohlfahrt zu Gute gekommen. Im Jahr 1844 hat die Firma Schöttler die Straße zuerst chaussiert, dann hat das Bergamt die Chaussee übernommen und sie durch das Lerbachtal, durch das Dorf Lerbach am Schieferberg hinauf nach Klaustal weitergeführt. Später hat der Fiskus Die Chaussee übernommen, welcher noch jetzt für die Unterhaltung der Chaussee zu sorgen hat. Seit 1885 sind die Hauptstraße und einige Nebengassen in Freiheit abends erleuchtet und zwar bis 1896 durch Petroleumlampen. Seit 1896 wird durch elektrische Glühlichtlampen die Beleuchtung bewirkt welche von den Fabriketablissiment der Firma vor Allwörden und Badendiek aus mit Elektrizität gespeist werden. Dadurch ist Freiheit wohl eines der ersten Dörfer im Deutschen Reich gewesen, welches durch Elektrizität erleuchtet wird. - im Jahre 1892 erhielt Freiheit die Wasserleitung, wodurch der Ort von der Oberhalb Freiheit am sogenannten Eichenwäldchen im Lerbachtal entspringenden Quelle gutes Trinkwasser bekommt. Die Anlage der Leitung hat 20 000 Mark gekostet, wovon 18 000 Mark aus der Landeskreditkasse auf Amortisation angeliehen sind.
In den laufenden Jähret 1897 ist mit dem Bau einer Kleinbahn von Kreiensen-Osterode-Lerbach begonnen. Die Bahn wird dem Laufe der Chaussee durch Freiheit folgen und soll im Jahre 1898 vollendet werden.
Im Jahre 1897 ist die Telegraphenanlage hergestellt, wodurch die Fabriken im Eichental, von Allwörden und Badendiek und Friedrichs Telephonanschlüsse bekommen haben.
Nun noch einige Notizen über- die Schule mögen hier folgender, deren Entwicklung durch Nachrichten des jetzigen ersten Lehrer Herr Bergmann vorstehend noch besonders geschildert wird. Das bis zur Vollendung des gegenwärtigen Schulhause benutzte Schulgebäude ist im Jahre 1844 neu errichtet und zu 2 Klassen und zur Wohnung für 2 Lehrer eingerichtet. Nach Vollendung des Neubaues wird das alte Schulhaus verkauft werden und der Erlös aus demselben wird zur Deckung der Kosten, des -Neubaues verwandt werden. Das Schulhaus war früher berechtigt zum Bezug von Bauholz und eines Quantums Brennholz von jährlich 30 Meter. Durch das Ablösungsverfahren hat die Gemeinde für beide Berechtigungen die Summe von 3818 Mark erhalten und für den Bezug der Zinsen die Deckung der Ausgaben für die Schule übernommen, indem das fehlende aus Gemeindemittel zugeschossen wird. Dieses gegenwärtige Schulgebäude ist im Jahre 1897 und 1898 erbaut und soll nach dem -Bauplane und Kostenanschlage etwa 42000 Mark kosten mit der inneren Einrichtung wird es im Ganzen die Summe von 50 000 Mark kosten. Die Kosten sollen gedeckt werden durch das aus der Brennholzablösung der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital von 22 280 Mark, durch den durch Verkauf des alten Schulhauses zu erwartenden, Erlöß von etwa 6000 Mark. Die fehlende Summe soll von der Landeskreditanstalt angeliehen und durch Amortisation getilgt werden. Der Schulvorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:- Fargel, Pastor sec.an St.Aegidien in Osterode als Vorsitzender. Fr. Bergmann, erster Lehrer der Schule in Freiheit. Kaufmann Aug. Kallmeier. Zeugmachermeister, Karl Beushausen, Weber Wilhelm Ehrlich Eimermachermeister Theodor Nothdurft. Die Oberaufsicht führt als Kreisschulinspektor der Superintendent und: Pastor Banstaedt an der St.Jakobi Schloßkirche in Osterode. Der erste Beamte des Kreises Osterode ist der Königliche Landrat Geheimer Regierungsrat Rossländer zu Osterode.
Es folgt hierunter noch ein Verzeichnis der gegenwärtigen Hausbesitzer in Freiheit.
|
Haus-Nr. |
||
|
1 |
Friedrich Burchard, |
Gastwirt |
|
2 |
Bernhard Schmedemann, |
Schumachermeister |
|
3 |
Heinrich Mävers, |
Rentier |
|
4 |
Christian Merten´s, Ww. |
Rentnerin |
|
5 |
Karl Aschoff, |
Zeugmachermeister |
|
6 |
Ernst Hinrichs, |
Kaufmann |
|
7 |
Johannes Becker, J |
Tischler |
|
8 |
Adolf Koch, Ww. |
Schmied |
|
9 |
Wilhelm Ehrlich, |
Weber |
|
10 |
August Wassermann, |
Fabrikarbeiter |
|
11 |
Andreas Homburg, |
Fabrikarbeiter |
|
12 |
Louis Goslar, |
Tischlermeister |
|
13 |
Adolf Kohlstruck, |
Zeugmacher |
|
14 |
Louis Usbeck, |
Webermeister |
|
15 |
Andreas Borchers, |
Schäfer |
|
16 |
August Hühne, |
|
|
17 |
Wilhelm Lobert, |
Weber |
|
18 |
Karl Peinemann, |
Maurer |
|
19 |
August Weißleder, |
Waldarbeiter |
|
20 |
Heinrich Helbing, |
Webermeister |
|
21 |
August Wildt, |
Werkmeister |
|
22 |
Ferdinand Becker, |
Weber |
|
23 |
Fritz Borchers, |
Maurer |
|
24 |
Friedrich Böhme, |
Weber |
|
25 |
Ernst Leonhard, |
Zeugmacher |
|
26 |
Fritz Nothdurft, |
Weber |
|
27 |
AlbertS amson, |
Färber |
|
28 |
Ernst Lobert, |
Fabrikarbeiter |
|
29 |
Wilhelm Jahn, |
Zeugmacher |
|
30 |
Karl Meve, |
Spinner |
|
31 |
Georg Wildt, |
Zeugmacher |
|
32 |
Louise Lüllemann, (verw. Grösche) |
Ehefrau |
|
33 |
Wilhelm Bierhance, Ww. |
Lademeister |
|
34 |
Karl Wildt, |
Zeugmacher |
|
35 |
Louise Niemeier, |
Fabrikarbeiter |
|
36 |
August Nagel, |
Chausseewärter |
|
37 |
August Macke, |
Zeugmacher |
|
38 |
August Becker, |
Zeugmacher |
|
39 |
Wilhelm Beushausen, |
Zeugmacher |
|
40 |
Wilhelm Lehnert, |
Kaufmann |
|
41 |
Christian Kiel, |
|
|
42 |
Friedrich Hundt, |
Weber |
|
43 |
Otto Gebser, |
Fabrikant |
|
44 |
Otto Rosental, |
Zeugmacher |
|
45 |
Wilhelm Borchers, |
Zeugmacher |
|
46 |
Heinrich Später, |
Arbeiter |
|
47 |
von Allwörden & Badendiek |
Fabrikbesitzer |
|
48 |
Wollgarnspinnerei Eichental Aktiengesellschaft |
|
|
49 |
Anton Lobert, |
Maler |
|
50 |
August Rott, |
Tischlermeister |
|
51 |
Georg Rott, |
Handarbeiter |
|
52 |
Fritz Stoffregen, |
Weber |
|
53 |
Heinrich Gümpel, |
Steinbrucharbeiter |
|
54 |
Fritz Ketler, |
Büttner |
|
55 |
Wilhelm Spillner, |
Schlosser |
|
56 |
Wilhelm Willig, |
Fruchthändler |
|
57 |
Louis Stöver, |
Zeugmacher |
|
58 |
Fritz Müller, |
Fuhrmann |
|
59 |
Karl Stoffregen, |
Zeugmacher |
|
60 |
Heinrich Bode, |
Handarbeiter |
|
62 |
J.C. Jena, |
Zigarrenfabrikant in Braunschweig |
|
63 |
Roßschlachter |
|
|
64 |
Wilhelm Wildt, Ww. |
Zeugmacher |
|
65 |
Fritz Lüer, |
Weber |
|
66 |
Levin (Fabrik Wolldecken) |
|
|
67 |
Altes Schulgebäude |
|
|
68 |
August Müller, |
Weber |
|
69, 70 |
Wilhelm Friedrichs, |
Maschinenfabrkant |
|
71 |
Heinrich Renziehausen, |
Bäckermeister |
|
72 |
August Meve, Ww. |
|
|
73 |
Louis Maltzahn, |
Bäcker |
|
74 |
Theodor Fischer, |
Zeugmacher |
|
75 |
Karl Nolte, |
Tischler |
|
76 |
Heinrich Liebau, |
Weber |
|
77 |
August Kallmeier, |
Fabrikant |
|
78 |
Karl Dieckhoff, |
Schlachter |
|
79 |
Fritz Ude, |
Dachdeckermeister |
|
80 |
Emil Mangold, |
Maler |
|
81 |
Ww. Später, geb. Merten |
|
|
82 |
Georg Kohl, |
Bäckermeister |
|
84 |
Ludwig Eckert, |
Bäckermeister |
|
85 |
Ferdinand Hübener, |
Realgymnasiallehrer |
|
86 |
Karl Waßmann, |
Kupferhammerschmied |
|
87 |
Karl Beushausen, |
Zeugmachermeister |
|
88 |
Friedrich Weber, Ww. |
Fuhrmann |
|
89 |
Henriette Dörge, |
|
|
90 |
August Windhausen, |
Gemeindevorsteher |
|
91 |
Wilhelm Reißner, |
Fabrikaufseher |
|
92 |
Mai, Ludwig |
Gipsmüllergehilfe |
|
93 |
Karl Rojan, |
Weber |
|
94 |
Adolf Lobert, |
Weber & Schankwirt |
|
111 |
Bernhard Ehrlich, |
Maschinenschlosser |
|
112 |
Ernst Lange, |
Schlosser |
|
113 |
Fritz Strickroth, |
Weber |
|
114 |
Louis Lobert, |
Weber |
|
115 |
Adolf Koch, |
Fuhrmann |
|
116 |
Konstantin Metzner, |
Tuchmacher |
|
117 |
Friedrich Merten, |
Wollsortierer |
|
118 |
Ferdinand Kiel, |
Schlachter |
|
119 |
Anton Kehr, |
Fabrikleiter |
|
120 |
Julius Schuhmacher, |
Tischler |
|
121 |
Zacharias Gebhardt, |
|
|
122 |
Ernst Gödecke, |
Weber |
Freiheit , den 13. Juli 1897
Der Gemeindeausschuss Der Schulvorstand.
Der Vorsitzende
A.Windhausen gez. Fargel
Pastor sec.St.Aegidien zu Osterode a.Harz
Schule 1897
Osteroder Kreisanzeiger 12.07.1997:
Grundsteinlegung für das Freiheiter Schulgebäude vor 100 Jahren
Schulverweis vom Magistrat
Von Albrecht Schütze
FREIHEIT. Vor 100 Jahren, am 13. Juli 1897, fand die feierliche Grundsteinlegung für das Freiheiter Schulgebäude „Hauptstraße 81" statt. Es war bereits das dritte Schulhaus, denn die Schulerzahlen stiegen von Jahr zu Jahr.
 Während das erste und zweite Schulhaus als Wohnhaus gebaut und zu Unterrichtszwecken umgestaltet worden war, legte man 1897, den Grundstein zu einem Gebäude, das ausschließlich als Schule genutzt werden sollte. Vier Klassenräume sollte das neue Schulhaus umfassen und bot damit, im Vergleich zur vier Jahre zuvor erbauten Bürgerknabenschule der Stadt Osterode, ein gleichwertiges modernes Schulhaus.
Während das erste und zweite Schulhaus als Wohnhaus gebaut und zu Unterrichtszwecken umgestaltet worden war, legte man 1897, den Grundstein zu einem Gebäude, das ausschließlich als Schule genutzt werden sollte. Vier Klassenräume sollte das neue Schulhaus umfassen und bot damit, im Vergleich zur vier Jahre zuvor erbauten Bürgerknabenschule der Stadt Osterode, ein gleichwertiges modernes Schulhaus.
Anlaß zu diesem Neubaus mag auch ein Streit zwischen Osterode und der selbständigen Gemeinde Freiheit gewesen sein. Zahlreiche Freiheiter Kinder besuchten die Schulen der Stadt, zahlten dort auch das geforderte Schulgeld und blieben dennoch Gastschüler. Zum Jahresbeginn 1872 wurden sie von den Osteroder Schulen verwiesen, weil die Erwartung, Freiheit einzugemeinden, sich nicht zu erfüllen schien. In der Schulchronik steht dazu vermerkt „... mit drakonischen Mitteln versucht der Magistrat der Stadt Osterode den Anschluß an die Stadt zu erzwingen, welcher von den Bewohnern der Freiheit abgelehnt war..."
So nahm ab Januar 1872 die Schulraumnot in Freiheit erheblich zu. Weder ausreichend Schulraum, noch genügend Lehrpersonen waren für etwa 200 Schulkinder vorhanden. Die zum 15. Oktober 1872 wirksam gewordenen „allgemeinen Bestimmungen, über den Volksschulunterricht" führten dazu, daß ab Ostern 1873 in Freiheit eine dreiklassige Schule entstand, die jedoch nur mit zwei Lehrern besetzt war. Die Unterichtsversorgung verschärfte sich durch wachsende Erwartungen an die Schule bei steigenden Schülerzahlen und fehlenden Lehrpersonen.
Besonders durch den Fortgang des Lehrers Ferdinand Weisleder (1874) nach Northeim, drohte ein Notstand einzutreten. Der Gemeindevorstand beschloß trotz knapper Finanzmittel, den Lehrer Bergmann aus Lerbach als künftigen zweiten Lehrer mit dem gleichen Gehalt eines ersten Lehrers einzustellen, um die Unterrichtsversorgung zu sichern. Mit Lehrer Bergmann unterrichtete auch Lehrer Adolf Gölitz (l. Lehrer), der mit Pastor Schmidt sowie mit Pastor Max trotz der erschwerten Bedingungen zusätzliches Bildungsmöglichkeiten für sozial schwach gestellte Familien eingeleitet und umgesetzt hatte (Gründung der Industrieschule 1851 für junge Mädchen und Gründung der Kinderbewahranstalt).
Dieses zweite Schulgebäude (1844-1898), das auf dem heutigen Gelände „Parkplatz Kaisers" stand, konnte die schulischen Erwartungen der Gesellschaft schon lange nicht mehr erfüllen. Ein Bauplatz war schnell gefunden, die • Finanzierung wurde möglich gemacht, indem das alte Schulhaus verkauft wurde und die Brennholzablösung der Gemeinde, dazu eine Kreditaufnahme den Gesamtbetrag von 50 000 Mark abdeckten.
Am 13. Juli fanden sich zur Grundsteinlegung der Gemeindevorstand, Baurat Mende, Maurermeister Kirchhoff und viele Gemeindemitglieder ein. Pastor Fargel eröffnete die Feier mit einer Ansprache. Pastor Fargel legte anschießend einen vom Maschinenfabrikanten Wilhelm Friedrichs gestifteten Zinkblechkasten mit elf Dokumenten ein. Er beinhaltete Nachrichten unter anderem über die hiesigen Gemeindeverhältnisse, Nachrichten über die Entwicklung des hiesigen Schulwesens und zwei Ausgaben des Allgemeinen Anzeigers. Der Zinkkasten wurde verlötet und eingemauert.
Aus vier Jahrhunderten - Bilder aus der Geschichte der St.Aegidiengemeinde,
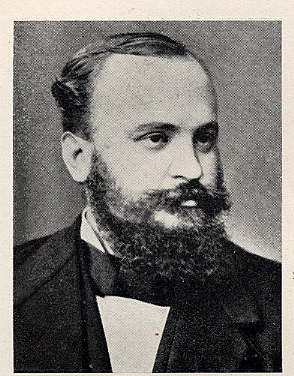
Ubbelohde, Eduard Wilhelm August * 06.11.1851
Aus vier Jahrhunderten - Bilder aus der Geschichte der St.Aegidiengemeinde,
Osterode a.H. Sorge'sche Buchhandlung 1891
Seite 55:
Freiheit, wo wir von 1 637 an eine Schule finden
Seite 120:
Ähnlich, wenn auch nicht in so weit gehender Weise, wie der Rat in Ührde, suchte in derselben Zeit die Regierung für die von ihr abhängigen Dörfern Lasfelde, Freiheit zu sorgen. In Freiheit leitet von 1637 bis 1661 eine Lehrmeisterin Ursula Seckels aus Halle in Schwaben, die Witwe des Messerschmieds Martin Richter aus Wurtzen, den Untericht. Nach ihrem Tode wurde Johann Daniel Külstein als erster Lehrer der Freiheit angestellt.
Seite 129:
Von Lerbach sagen 1 729 die Pastoren Rancke und Münter, daß etwa fünf bis sechs Häuser dort vorhanden seien, die wenig mehr als das liebe Brot hätten, indessen die anderen alle gar kümmerlich leben und ihr Brot saure Arbeit in der Welt hin und wieder suchen müßten. Und ähnlich war es in Freiheit. In beiden Orten faßte später die Weberei festen Fuß, bis nach dem Aufblühen des Hüttenbetriebes die Bevölkerung von Lerbach sich wieder der Berg = und Hüttenarbeit zuwandte. Die Lage von Freiheit am Ausgang des bis hart unter das Plateau von Clausthal führenden Lerbachthales eröffnete im Laufe der Zeiten den Bewohnern des Dorfes noch einen anderen freilich manchmal recht mühseligen, aber einträglichen Erwerbszweig, den der Fruchtreiberei, der Versorgung des Oberharzes mit erforderlichen Brotkorn. Für Rechnung der in Osterode wohnenden Getreidehändler besorgten die Freiheiter Fruchtreiber mit Mauleseln, die sie in großer Zahl sich hielten, die wertvolle Frucht über den Rücken hinauf auf den Markt nach Clausthal. Erst die Erbauung der nach Clausthal führenden Eisenbahn hat diesem Erwerbszweige ein ende bereitet.
Eine ,,Gemeindegründung" bei Osterode um das Jahr 1848
Osteroder Kreisanzeiger Juli 1981.
Im Harzraum ist man in den letzten Jahren durch eine Verwaltungs- und Gebietsreform hindurchgegangen, und auch in der Folgezeit kam eine Veränderung zur anderen. Aber es scheint so, als ob der Mensch Zuständigkeiten nur schafft, um sie wieder verändern zu können. Die Revolution des Jahres 1848 war auch ein Anstoß, um politische Zuständigkeiten zu wandeln, ebenso wie Verfahrensweisen. Ein merkwürdiges Beispiel der Mitwirkung der einfachen Bürger bietet hier der Vorschlag einer Neugründung eines Gemeindeverbandes im Bereich Osterode.
In 19 Paragraphen wird im Jahre 1848 versucht, die neuen politischen Ideen praktisch etwa mit einer Abstimmung und Stimmenmehrheit zu aktivieren. Damals gab es noch keine organisierten Parteien, über welche heutzutage solche Vorhaben wohl laufen mußten. - Betrachten wir deshalb einmal, wie man damals unter sich solche Neuordnungen formulierte, als man noch nicht über eine langjährige Erfahrung in Anträgen verfügte.
Entwurf der Prinzipien über den Zusammentritt
der Ortschaften Freiheit und Gartenhäuser zu einem Gemeindeverbande
Paragraph 1:
Die Ortschaft Gartenhäuser tritt vom 1 Januar 1849 an mit der Amts-Freiheit zu einem Gemeindeverband zusammen.
Paragraph 2:
Zur Ortschaft Gartenhäuser gehören alle die Häuser welche im jetzigen Amtsjurisdiktionsbezirk um die städtische Gerichtsgrenze belegen sind oder erbaut werden bis an die nächste Amtsortschaft der Flur, und wo solche nicht mehr ist, bis an die Amtsgrenze
Paragraph 3:
Es gehören also auch dazu der Feldbrunnen, das Gut Lindenberg und sämtliche herrschaftlichen und domanale Etablissements.
Paragraph 4:
Der Vorstand dieser Gemeinde wird gebildet aus einem Bauermeister und vier Vorstehern. Die Hälfte der letzteren wird gewählt aus der Freiheit, die Hälfte von allen übrigen Hausbesitzeren. Falls die Entlegenheit der Wohnung des Bürgermeisters es nützlich oder wünschenswert macht, wird für die betreffende Zeit einer der an geeigneter Stelle wohnenden Vorsteher ein für allemal für alle Fälle zu den Funktionen des Bauermeisters autorisiert.
Paragraph 5:
Die Bauermeister bedürfen wie bei allen Gemeinden, der Amtsbestätigung, und die Wahl kann, wenn das Amt Gründe dazu hat, verworfen werden.
Paragraph 6:
Das Vorsteheramt ist ein Ehrenamt. Es kann ohne dringenden Gründe nicht abgelehnt werden. Nach zwei Dienstjahren kann ein Vorsteher seine Entlassung verlangen.
Paragraph 7.
Nur ein Hausbesitzer ist in den Vorstand wählbar.
Paragraph 8:
Die eingetretenden Häuser sollen rücksichtlich des Beitrages zu den Gemeindelasten in zwei Klassen geteilt werden, deren erstere zwei, in 2.Klasse ein Teil zu erlegen ist.
Paragraph 9:
Diese Monatssimpla von 24 und 12 RT werden - wie auf der Freiheit, so oft gehoben, als es die Ausgabe erfordert.
Paragraph 10:
Die Häuslinge zahlen mit der zweiten Klasse der Hausbesitzer gleichmäßig.
Paragraph 11:
Auf der Freiheit behält es bei den in ähnlicher Art feststehenden Beträgen sein Bewenden.
Paragraph 12:
Aus diesen Einnahmen werden zunächst die Lasten bestritten, welche für den ganzen Verband gemeinschaftlich oder nach gesetzlichen Bestimmungen als gemeinschaftlich anzunehmen sind z.B. die Kosten des Vorstands und der Versammlungslokale, die Armenverpflegung usw.
Paragraph 13:
Zu sonstigen Lasten kann jeder Teil nur nach dem Verhältnisse herangezogen werden, nach welchem er an den Zwecken teil hat, die diesen Lasten zugrunde liegen.
Paragraph 14:
Sieben der Gartenhäuser tragen von altersher ein Drittel der Kavallerie-Bequartierungslast der Ortschaft Petershütte und Katzenstein. Die jetzt störende Verhältnis soll dahin abgeändert werden, daß letzteren beiden Orten ein Drittel der Last ab und der Freiheit zugesetzt wird.
Paragraph 15:
Die Natural- oder Geldabgaben, welche bei heiratenden oder neu einziehenden Hausbesitzern oder Häuslingen auf der Freiheit zu leisten oder in die Armenkasse zu legen sind, sollen von jetzt an auch in den Gartenhäusern eingeführt werden.
Paragraph 16:
Trifft einzelne Teile der vereinigten Gemeinde eine besondere Last, auf deren Tragung die Paragraphen 8 und 10 nicht passen, so steht es den Beteiligten frei, durch Stimmenmehrheit einen anderen Beisteuersatz zu bilden.
Paragraph 17:
Wenn sich im Laufe der Zeit Häuser so verändern, daß die bisherige Beitragsklasse nicht mehr paßt, so tritt die Versetzung in die richtige Klasse durch Gemeindebeschluß ein.
Paragraph 18:
Dem Hospital St.Eobaldi (der Sichenhoff) soll, solange er seiner jetzigen Bestimmung als Armen- oder Krankenhaus dient, von Kommunallasten frei gelassen werden, wenn sich die Stadt verbindlich verpflichtet,
a. daß keiner der Bewohner der Gemeinde zur Last fällt,
b. kein Domicilrecht in selbiger, sondern lediglich in der Stadt erwirbt,
c. das Etablissement der Gemeinde ansonst keine weiteren Ausgaben oder andere Last verursacht.
Paragraph 19:
Die schon früherhin verabredeten, aber großenteil nicht ein- gegangenen Beiträge der Gartenbewohner sollen nicht nachgefordert, dagegen die jetzt festgestellten vom 1 .Januar 1849 an gezahlt werden.
Dies also ist der Wortlaut der damaligen Vorstellungen über die neuzubildende ,,Großgemeinde" Freiheit und Gartenhäuser. Sicherlich ist es intressant, sich mal die Abgrenzung dieses Gebietes innerhalb der heutigen Stadt Osterode vorzustellen, aber auch eigenartige Bezeichnungen, wie Bauermeister, Amtsortschaft, domanal (etwa staatlich), näher zu betrachten. Der Entwurf hat sich in die Akten der frühren Berghauptmannschaft verirrt bzw. war ja diese bis 1866 für alle nichtstädtischen und im Harzgebiet liegenden Ansiedlungen verantwortlich - vor allem eben auf ,,domanalem" Gebiete, also etwa im Bereich der Berg- und Forstämter, der Hütten, Pochwerke und Gruben.
Renner - Auszüge

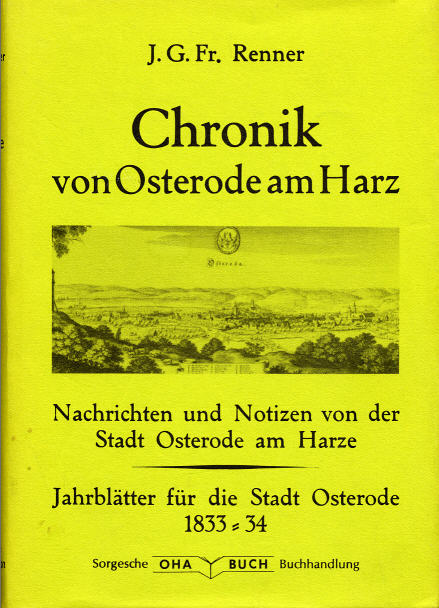

- Renner, Dr. J.G.Fr.: Aus der Geschichte der Stadt Osterode am Harz; Osterode bei August Sorge; 332 S.; 1833;
- Renner, Dr. J.G.Fr.: Aus der Geschichte der Stadt Osterode am Harz; Paul Krösing Osterode; 242; 1926;
- Renner, Dr. J.G.Fr.: Aus der Geschichte der Stadt Osterode am Harz; Verlag der Sorgischen Buchhandlung; 332 S., 100; 1977;
Reprographischer Nachdruck der Erstausgabe Osterode 1833 und Osterode 1834
Diese Neuausgabe vereinigt im Faksimiledruck zwei Werke des Dr. J.G.F. Renner, zu seiner Zeit Konrektor am Progymnasium zu Osterode.
Das erste nennt sich "Historisch-, topographisch-ststistische Nachricht und Notizen von der Stadt Osterode am harz" von 1833. ...
Diese Darstellung scheint in der Bevölkerung auf großes Intresse gestoßen zu sein, denn schon im darauf folgenden Jahr ließ er einen Nachtrag für die Jahre 1833 und 1834 fogen ... Diese Nachträge erhielten den Titel: "Jahrblätter für die Stadt Osterode".
Seite 39-40:
Herzog Albrecht III. ...
Im Jahre 1474 gab der Herzog Albrecht II. der Stadt Osterode das Pivilegium, daß auf der Freiheit vor Osterode Niemand Kaufmannschaft treiben solle, es geschähe denn mit des Raths Wissen und Willen.
Seite 56:
Herzog Wolfgang ertheilt der Stadt Osterode wichtige Privilegien
Es hat der Herzog Wolfgang unserer Stadt ein Privilegium ertheilt, nah welchem auf dem Amtsdorfe, die Freiheit vor Osterode, kein Weinschank getrieben werden darf. Auch das Privilegium rührt von diesem Herzoge her, nach welchem auf besagter Freiheit keine Bierbrauerei angelegt werden darf.
Seite 76
Hans von Eisdorf beunruhigt Osterode.
Kurz vor Pfingsten 1627 schickte Hans von Eisdorf (richtiger Hans aus Eisdorf) der Stadt Osterode einen Fehdebrief zu, und am Pfingstmontage ergriffen seine Spießgesellen vor der Stadt Osterode einen Bürger, Namens Andreas Segelcken, und schlugen ihn todt. Zwei Tage hernach kamen sie mit fliegender Fahne wieder vor die Stadt, lagerten sich auf der Freiheit auf einem Hügel, wohin sie aus der Stadt Brot, Bier, Wein lc. holen ließen, welche Lebensmittel sie nicht' geneigt waren, zu bezahlen. Beim Abzuge nahmen sie überdies noch Kühe, Schaafe und Pferde mit sich davon. Die Bürger hierüber mit Recht entrüstet, jagten ihnen nach, nahmen ihnen das geraubte Vieh weg, und machten 1 Schnapphahn, aus Echte gebürtig, zum Gefangenen. ...
Seite 92
Aufhebung der fürstlichen Regierung in Osterode.
Zur Zeit des Herzogs Ernst August wurde (1686) bei Osterode eine neue Grube, die neue Freiheit genannt, ausgenommen, aber nur einige Jahre betrieben, und dann wieder eingestellt.
Seite 94, 95:
Wohltätige Verfügung für die Stadt Osterode, in Hinsicht der Handwerker auf der Freiheit.
Nach dem Ableben Georgs I. am 22. Junius 1727, wurde dessen Sohn, Georg II. König von Großbritannien und Kurfürst von Hannover. Dieser erhabene Monarch, welcher alle Eigenschaften eines vorzüglichen Regenten in sich vereinigte, verließ recht oft sein Inselreich, und begab sich in sein hannöveriches Erbland (in den Jahren 1729, 1732, 1735, 1736, 1740, 1741, 1743, 1745, 1748, 1750, 1752, 1755), um sich durch seine Anschauung von dem zu überzeugen, was die Wohlfahrt seiner deutschen Unterthanen am besten befördern könnte. Von diesem trefflichen Regenten, unter dem der Wohlstand des Landes sichtbar gedieh, hat unsere Stadt (Osterode) unter Anderen am 16. Februar 1740 das Privilegium erhalten, nach welchem auf der Freiheit vor Osterode nur 3 Bäcker, 1 Schneidermeister, 5 Nagelschmiede und 3 Kleinbinder wohnen dürfen. Diese Professionisten sind verbunden, die Gilde mit der Stadt zu halten.
Nach dem landesherrlichen Reskripte vom 29. März 1752 darf auf der Freiheit kein Knochenhauer wohnen. Im Jahre 1827 ließ sich daselbst 1 Knochenhauer mit Konzession der königlichen Landdrostei in Hildesheim nieder, hat aber bisjetzt die Aufnahme in die Knochenhauer Gilde nicht erlangen können.
Der von seinen Untertanen hochverehrte König und Kurfürst Georg II., welcher durch die i. J. 1734 gestiftete und am 17. September 1737 eingeweihte Universität Göttingen sich auch als einen hohen Beförderer der Gelehrsamkeit und der Wissenschaften bewiesen hat, endete am 25. Oktober 1760 sein tatenreiches Leben, und hatte seinen Enkelsohn Georg III., zum Nachfolger.
Seite 123, 124:
Es werden Truppen aus der Stadt verlegt.
Kaum waren die Franzosen eine Woche in Osterode gewesen, so zeigte sich auf eine unverkennbare Weise die große Armuth vieler Bürger, welche nun magistratsseitig von der Einquartierungslast, frei gesprochen wurden. Die Soldaten und Unteroffiziere verlangten sehr häufig einen Wechsel ihrer Quartiere, hoffend, dadurch ein besseres Logis zu bekommen. Dies geschahe aber nur selten, und so wurde die Unzufriedenheit der Soldaten und die der Bürger immer größer. Der Magistrat bat daher den General dringend, einige Truppen aus der Stadt zu verlegen. Dies, geschahe auch am 13. Oktober, als an welchem Tage die 94. Halbbrigade (etwas über 400 Mann) nach Nordhelm marschirte, und die chasseurs á cheval (100 Mann stark) sich in die Pfarrdörfer Berka, Dume und Hammenstedt begeben mußten. Den Tag darauf, als am 14. Oktober, wurde die 8. Kompagnie der hier gebliebenen 95. Halbbrigabe auf die Freiheit verlegt. Die hiesige Stadt blieb aber dennoch immer mit mehr als 700 Mann bequartiert. Da aber die Zahl der Einquartierung tragenden Bürger mit jedem Tage kleiner wurde; so mußte der Magistrat noch auf eine Verminderung bedacht sein. Er hoffte dies durch ein dem General Werlé zu machendes Geschenk zu bewirken, und zu diesem Zwecke erhielt der Bürgermeister 1500 [ ] in Golde, mit welchen er sich zum General verfügte, ihm vorstellte, daß bei der Armuth und Nahrungslosigkeit der Stadt 700 Mann Einquartierung immer noch zu viel sei, und dann auf`s dringendste bat, diese Zahl noch zu vermindern. Nach dieser gemachten Vorstellung und Bitte empfahl sich der Bürgermeister, indem er auf den Tisch die mit Gold gefüllte Rolle legte, welche nicht zurückgeschickt wurde, und den Erfolg hatte, daß am 20. Oktober die 1. Kompagnie der 95. Halbbrigade, aus 68 Mann bestehend, nach dem Flecken Herzberg verlegt wurde.
Seite 127, 128:
Oberst Bonnet vermindert die Einquartierung.
Nach dem Abgange des Generals Werlé war hier der Oberst Bonnet als Stadtkommandant die höchste Militärperson. Da derselbe zur Verminderung der Einquartierung nicht ernstlich Anstalt machte; so ging die Meinung des sämmtlichen Magistrats dahin, durch ein Geldgeschenk sich das besondere Wohlwollen des Stadtkommandanten zu erwerben, und dadurch der bedrängten Bürgerschaft einige Erleichterung zu verschaffen. Nach sorgfaltiger Berathung wurde beschlossen, dem Obersten Bonnet 400 [] in Golde, dem Platzmajore aber 100 [] durch den Bürgermeister, es versteht sich, auf eine feine Weise, überreichen zu lassen. Dieser Beschluß wurde ausgeführt; allein das Geldgeschenk wurde nicht angenommen; jedoch den andern Tag ließ sich der Platzmajor bei dem Bürgermeister nach dem Preise der Pferde erkundigen. Man verstand, wohin diese Anfrage ziele, und der Magistrat beschloß, dem Stadtkommandanten, so wie dem Platzmajore ein Reitpferd mit Sattel und Zeug zum Geschenk zu machen.
Mittlerweile zeigte sich der Oberst Bonnet geneigt, einige Truppen aus der Stadt in die um die Stadt sich befindenden, in die Amtsjurisdikzion gehörenden Häuser zu legen. Mit dieser Anordnung war aber das Amt nicht zufrieden; dasselbe wollte nämlich einige Mannschaft von der Freiheit in die bezeichneten Häuser verlegt wissen. Es blieb dem Magistrate nun kein anderes Mittel übrig, als sich an den General Werlé in Nordheim zu wenden. Da auch der Oberst Bonnet zugleich ein Schreiben an den General beilegte, in welchem er die Armuth und Nahrungslosigkeit der Bürger schilderte; so verfügte dieser, daß am 20. Noveber die 3. und 4., Kompagnie in die Pfarrdörser Dorste und Schwiegershausen verlegt wurden. Der Oberst Bonnet erhielt hierauf von Seiten des Magistrats eine schriftliche Danksagung. Am 21. November geschahe eine allgemeine Umquartierung aller Soldaten und Unteroffiziere, und man fand, daß die Zahl derselben, ohne Offiziere, sich auf 326 Mann belief.
Seite 166:
Ausmarsch und Marschroute nach den Niederlanden
Ein Soldat von der 1. Kompagnie, Namens Ibenthal, von der Freiheit bei Osterode gebürtig, ertrank ebenfalls am 16. Juli beim Baden in der Seine. Der Körper desselben wurde erst am folgenden Tage gefunden.
Seite 194:
Standpunkt zur besten Übersicht der Stadt und ihrer Umgebung.
Von dem Scheerenberge zieht sich der Harzwald in nördlicher Richtung hinter der Freiheit, einem Arntsdorfe, und am Bremekerthale nach Westen, bis hinter den braunschweigischen Flecken Gittelde, in dessen Nähe sich dem forschenden Auge auf der Kuppel eines hervorragenden Berges die Trümmer der zerstörten Staufenburg zeigen, einst eine der prächtigsten Vesten Niedersachsen's, auf welcher namentlich der sächsische Herzog und nachmalige deutsche Kaiser Heinrich der Finkler, nach genossenem Jagdvergnügen gern weilte, und die bekannte Eva von Trott, Geliebte des Herzogs Heinrich d. J. von Braunschweig viele Iahre in Verborgenheit lebte. An die Staufenburg schließen sich mannichfaltige Berggruppen an, welche westlich und nördlich die Aussicht begrenzen.
Seite 200:
Wochenmärkte
Die Stadt Osterode hat 2 Wochenmarkte, welche am Morgen des Montags und Donnerstags gehalten werden. An den Markttagen wird auf dem Marktplatze eine rothe, kleine Fahne ausgesteckt, und ehe dieselbe nicht eingezogen wird, darf kein Fremder oder Auswärtiger etwas kaufen. Die Einwohner der Freiheit werden den Fremden gleich geachtet. Von Ostern bis Michaelis bleibt am Morgen der beiden Markttage die bemerkte Fahne bis um 9 Uhr ausgesteckt; von Michaelis aber bis Ostern zieht man sie um 10 Uhr ein. Nach Gutbefinden des Polizeisenators kann die Fahne auch früher abgenommen werden, wenn nämlich der Markt mit Verkäufern überfüllt ist. Auf die Wochenmärkte bringen die benachbarten Landleute die Erzeugnisse ihres Ackers, und kaufen dagegen Waaren und Fabrikate ein, wie ihre Bedürfnisse es erheischen.
Seite 210-211:
Polizeiliche Einrichtungen
Die Reinlichkeit der Straßen, welche einer Stadt so sehr zur Zierde gereicht, bleibt hier keinesweges unbeachtet. Durch die Stadt wird ein Theil des Baches, welcher die Apenke heißt, geleitet, durchweichen die Straßen der Stadt wöchentlich zweimal, Mittwochs und Sonnabends, gereinigt werden. Auf das Aufeisen der Gossen zur Winterszeit wird sorgfältig geachtet. Zu jeder Zeit wird scharf auf Ruhe und Ordnung auf den Straßen gesehen, und die innere Sicherheit der Stadt wird durch die hier liegende königliche Landdragonerbrigade sehr gesichert. Die Nachtwächter, deren 4 sind, und von denen immer 2 und 2 gehen, rufen von 10 Uhr des Abends bis 4 Uhr des Morgens nach jeder Stunde die Zeit aus, und blasen in's Horn, wenn 1 Stunde abgelaufen ist. Der Thurm der Egidienkirche ist ebenfalls von einem besondern Wächter bewohnt. Wenn Feuer ausbricht und der Thurmwächter die Flamme sieht, so ist er verpflichtet, die Sturmglocke zu ziehen. Geschieht es bei Tage, so muß er nach der Gegend hin, wo das Feue» ausgebrochen ist, eine rothe Fahne ausstecken, bei Nachte aber hat er eine Laterne nach der Gegend, wo das Feuer ist, auszuhängen. Wenn ein Feuer in der Stadt und in den beiden Vorstädten ausgebrochen ist, so wird mit der großen Glocke gestürmt; bei einem Feuer aber in den um die Stadt liegenden Gartenhäusern und auf der Freiheit, so wie in den benachbarten Dorfschaften Petershütte, Laßfelde ec., wird zum Stürmen die kleine Glocke gebraucht.
Seite 243:
Bierbrauerei
... Die Freiheit und die Dorffschaften Petershütte, Laßfelde, Katzenstein und Eisdorf sind verbunden, das benötigte Bier aus dem Brauhause der Stadt Osterode zu nehmen, wofür die Brauerschaft aber jährlich eine gewiße Pacht an das hiesige Amt bezahlen muß.
Übrigens wollen wir hier noch bemerken, daß der Herzog Wolfgang der Stadt Osterode das Privilegium gegeben hat, nach welchem auf de Freiheit vor Osterode keine Bierbrauerei angelegt werden darf.
Seite 246, 247:
Wollenzeugfabriken
Im Jahre 1831 hatten die Wollenzeugfabriken zusammen 125 Stühle im Gange, und beschäftigten täglich hier und in dem Amtsdorfe, die Freiheit genannt, wenigstens 550 Arbeiter, unter denen sich viele Kinder und junge Leute, besonders junge Mägdchen, befinden. Außer dieser genannten Zahl von Arbeitern finden noch mehre Familien in Lerbach und auf dem Eichsfelde, zusammen gegen 150 Personen, Beschäftigung durch Handspinnerei. Das Arbeitslohn dieser 550 beträgt jährlich mehr als 46,000 [], ein für die Stadt Osterode bedeutender Geldumlauf. ...
- Gebrüder Dameral.
2. Gräseler und König. '
3. Greve und Uhl.
4. Ludolf Greve.
5. Wilhelm Greve d. Ä.
6. Wilhelm Greve d. J.
7. Johann Friedrich Struve.
8. Wilhelm Struve.
9. Schöttler und Schröder.
Die Herren Schöttler und Schröder wohnen eigentlich nicht in Osterode selbst, sondern in dem vor Osterode sich befindenden Amtsdorfe, die Freiheit genannt. Übrigens ist Herr Schöttler als Maschinenbauer im In- und Auslande rühmlichst bekannt, und seine wesentliche Verbeßerung der Stubenöfen (welche möglichst schnell Wärme geben, dieselbe lange erhalten, gleichmäßig im Zimmer verbreiten und wenig Brennmaterial erfordern) gewinnen immermehr die verdiente Aufmerksamkeit.
Seite 252:
Kaufmannschaft
Im Jahre 1474 gab der Herzog Albrecht II. der Stadt Osterode das Privilegium, daß auf der Freiheit Niemand Kaufmannschaft treiben solle, es geschähe denn mit des Stadtraths Wissen und Willen.
Seite 255:
Gilde der Bäcker.
In der Stadt Osterode sind 20 Bäckermeister, und vermöge eines besonderen Privilegiums darf diese Zahl nicht überschritten werden. Das vor der Stadt liegende Amtsdorf, die Freiheit genannt, hat am 16. Februar 1740 das Privilegium erhalten, daß einige begildete Handwerker daselbst ihre Geschäfte treiben können, und namentlich 3 Bäcker.
Seite 256, 257:
Gilde der Eimermacher.
Ein nicht unwichtiges Gewerbe ist in Osterode das der Eimermacher. Ihre Zahl beläuft sich auf 12 in der Stadt selbst und 3 auf der Freiheit. Sie liefern alljährlich zusammen 16 bis 1800 Schock Eimer. Da das Schock im Durchschnitte, groß und klein, zu 7[] berechnet wird; so betragt der Geldbetrag dafür über 11,000 []. — Das Eisenblech zu den Banden wird bis jetzt nicht vom Harze, sondern aus England bezogen, weil es daselbst wohlfeiler ist. Die dafür alljährlich nach England gehende Summe wird wenigstens auf 4000 [] angeschlagen. Auch der Drath oder das Rundeisen zu den Hängen der Eimer wird aus England bezogen, jährlich für etwa 1000 [].— Das Holz zu den Eimern wird aus der Harzforst bezogen, und muß für die Klafter 6 [] 4 [] Konvenzionsmünze, ohne das Fuhrlohn, bezahlt werden. Ein großer Theil der verfertigten Eimer werden nach Ostfriesland und nach den Hanseestädten Bremen und Hamburg zum Verkauf gefahren. Die Herren Eimermachermeister, welche zur Ausfuhr arbeiten, sind folgende: Jakob Bockelmann, August Enters, Heinrich Holland, Ernst Homann, Heinrich Krohme Senior, Heinrich Krohme Junior, Leopold Krohme's Wittwe, Ernst Mackensen, Georg Mackensen, Heinrich Mackensen, Ludwig Mackensen, Heinrich Später, Philipp Spater, Friedrich Stolze's Wittwe. Sehr zu beklagen ist es, daß wegen der hohen Zölle die Ausführung der Eimer sehr erschwert ist.
Die Eimermacher und die Bötticher (oder Büttner) bilden hier Eine Gilde. Gegenwärtig sind hier 5 Büttner.
Seite 258:
Gilde der Knochenhauer
Nach einem landesherrlichen Reskripte vom Jahre 1740 darf auf der Freiheit kein Knochenhauer wohnen. Der seit einigen Jahren daselbst wohnende Knochenhauer ist blos konzessionirt, und die Gilde in Osterode hat ihn nicht als Mitglied aufgenommen.
Seite 259:
Gilde der Leineweber
Die Zahl der Leinwebermeister beläuft sich jetzt auf 50, die 22 auf der Freiheit mit inbegriffen, wo laut der landesherrlichen Verordnung vom 16. Februar 1740 sich so Viele niederlassen können, als ihrer daselbst Nahrung finden. Diese Leinwebermeister arbeiten mit ihren Gesellen, jetzt 20 an der Zahl, für den Bedarf der Bürger und Einwohner der Stadt Osterode; Einige aber von ihnen arbeiten für die Fabriken der Herren Dieckhoff und Recht.
Seite 259, 260:
Gilde der Nagelschmiedemeister
Die Zahl der Nagelschmiedemeister in Osterode beläuft sich auf 3. Die Nagelschmiedemeister auf der Freiheit, 2 an der Zahl, welche durchs ein Privilegium (vom 16. Februar 1740) daselbst wohnen dürfen, haben sich an die hiesige Gilde angeschlossen. Sie machen alle Sorten von Nägeln, welche hier und in den benachbarten Ortschaften Absatz finden. In den hiesigen Nagelschmieden brennt man Stein- und Büchenkohlen. Bei den Nagelschmiedemeistern versieht immer der älteste Meister das Amt eines Gildemeisters; er wird daher Altmeister genannt, und verwaltet in der Regel sein Amt lebenslänglich.
Seite 260:
Gilde der Schneider
Im Jahre 1792 befanden sich hier 21 Schneidermeister mit 4 Gesellen; gegenwärtig aber (1832) ist die Zahl der Meister auf 36 gestiegen, und die der Gesellen auf 12 bis 15. Nach der schon angeführten landesherrlichen Verordnung vom 16. Februar 1740 darf auf der Freiheit nur Ein Schneidermeister wohnen.
Seite 274, 275:
Stiftung der St. Egidien= oder Marktkirche
Die Egidienkirchgemeinde ist theils Stadtgemeinde, theils Landgemeinde. Die Stadtgemeinde begreift innerhalb der Stadtmauern: den unteren Theil des Rollberges (eine Gasse, welche von der Petersilienstraße aus über den Rollberg läuft, ist hier als Grenze anzusehen), das Schild, den Rosenhagen, die Johannisstraße, Jüdenstraße, den Kohl- und Kornmarkt, die Straße am Marienthore, die Straße vom Kornmarkte bis zur Wage, die Petersilien- und Auenstraße, den Hellhof und die Scheffelstraße (auch deren beide letzten Häuser, welche mit einer Seite am Krummenbruche liegen, gehören noch hierher).
Außerhalb der Stadtmauer gehört zur Egidiengemeinde die Johannisvorstadt, die zum Kornmagazin gehörenden Wohnungen, die Gartenhäuser, welche diesseit der Söse, zwischen der Marienvorstadt und der sogenannten Abgunst liegen; ferner alle jenseit der Söse belegenen Gartenhäuser, wie auch die Häuser an der Bleichstelle.
Die Landgemeinde begreift die Freiheit. Oberhalb derselben befindet sich ein Försterhaus. Der jetzige Bewohner desselben, Herr Förster Breiding, hat sich bisher nach Lerbach gehalten, behauptet indessen, daß er sich mit eben demselben Rechte auch zur St. Egidienkirche in Osterode halten dürfe, da er an keine Kirchgemeinde bestimmt gewiesen ist, auch nirgends Vierzeitenopfer und andere bestimmte Parochialabgabeu entrichte. Gleiche Bewandniß hat es auch mit dem Wirthshause zum Breitenbusche, dessen Bewohner sich indessen beständig zur Egidiengemeinde gehalten haben. Es gehört ferner hierher: das Rothehaus, der Scheerenberg, die Eulenburg, die Weiler Riefensbeck und Kammschlacken im Sösethale, nebst einem 1/2 St. diesseit Riefensbeck belegenen Wohnhause, Limbach genannt; dann Laßfelde, Petershütte, Katzen, oder Kattenstein, die Schwarzehütte, die Landwehr bei Badenhausen und der Siechenhof bei der Sösebrücke an der Wagelos.
Seite 311, 312:
Ölmühlen
Im Stadtgebiete liegen 2 Ölmühlen. Außer, diesen befinden sich um die Stadt herum noch 3, welche in's Amtsgebiet gehören, so wie noch 1 auf der Freiheit vor Osterode. Diese Ölmühlen versorgen nicht nur die Stadt Osterode hinlänglich mit Öl, sondern sie machen auch damit in benachbarte Ortschaften Versendungen.
Seite 320, 321:
Benachbarte Wergnügungsörter, oder: das Rothehaus, der Breitebusch und die Petershütte.
Die schönen Umgebungen der Stadt Osterode tragen sehr viel zum Vergnügen ihrer Bewohner bei. Je mehr man mit seinen Spaziergangen abwechselt, desto mehr Zerstreuung und Erquickung kann man davon erwarten. Liebhaber einer weiten Aussicht gehen gern nach dem Rothenhause, von wo aus man den bekannten Meißner, im Hessenlande, erblicken kann. Hier vereinigen sich zur Sommerszeit, besonders des Sonntags, viele Einwohner und Bürger aus Osterode, um durch Kegel- und Billiardspiel, durch Tanz und andere Lustbarkeiten sich zu vergnügen. Für kalte und warme Getränke sorgt der Besitzer dieses Wirthshauses, Herr Koch, auf's bestmöglichste.
Auch der Besuch nach dem Brettenbusche reizt Den, der weite, schöne, malerische Aussichten liebt. Die nahe Umgegend des Breitenbusches soll mit verschiedenen Gegenden in der Schweiz viel Ähnlichkeit haben. Dem sei nun wie da wolle, so wird der Naturfreund diese Gegend gewiß nicht ohne Bewunderung verlassen. In den Sommermonaten werden hier oft Scheibenschießen gehalten.
Die schöne Allee, welche von der kleinen Sösebrücke beim Siechenhause nach Petershütte führt, bietet in den heißen Sommertagen den Lustwandelnden einen höchst angenehmen Spazierweg dar. Die erste Hälfte dieser Allee wurde nicht lange nach der Beendigung des siebenjährigen Krieges angelegt; die Anpflanzung der anderen Hälfte aber fällt in's Jahr 1811.
Seite 329, 330:
Königliches Amt Osterode
Dem Amte Osterode gehört die Mahlmühle beim Kupferhammer, die Rodemühle (Rothemühle) genannt. Sie ist i. J. 1750 massiv erbaut worden. In derselben müssen die Dörfer Laßfelde, Petershütte, Katzenstein, die Freiheit und die sämmtlichen Gartenhäuser um die Stadt Osterode mahlen lassen, und ist folglich eine Zwangsmühle. Die Kalkmühle an der Söse, unterhalb der heine'schen Kalkmühle belegen, gehört zum Amte Osterode. Sie wurde zuerst i. J. 1740 aufgebaut, und ist verpachtet.
Zudem alten Amte Osterode gehörten blos die Dorfschaften Laßfelde, Petershütte, Katzenstein und die Freiheit vor Osterode. Im J.1756 kam Eisdorf, Förste und Nienstedt hinzu, welche Dorfschaften sonst zum Amte Herzberg gehört hatten. Den Beamten in Herzberg wurden jedoch die Sporten von diesen Dorfschaften lebenslang gelassen. Im J. 1800 wurde das Amt Osterode durch das Dorf Schwiegershausen vergrößert, welches bis dahin zum Amte Herzberg gehört hatte, und im Sommer des Jahres 1832 erhielt es noch Dorste, ein bis dahin zum Amte Katlenburg gehörendes Dorf, woselbst sich ein adeliges Gut, das der Familie von Hedemann gehört, befindet.
In den Feldmarken, Wiesen, Angern und Büschen der Dörfer Laßfelde, Katzenstein, Petershütte und Freiheit hat das Amt Osterode privative oder einseitige Jagd, und mit dem Gute des Herrn von Oldershausen in Förste steht ihm die Koppeljagd zu.
Das Amt Osterode besitzt jetzt keine Holzungen. In früheren Zeiten aber soll es ansehnliche Holzungen gehabt haben, welche aber nachgehends den Harzforsten beigelegt worden sind. Die zum Amte gehörenden Dörfer haben, Eisdorf und Dorste ausgenommen, gleichfalls keine Forsten, und müssen das benöthigte Bau- und Brennholz da kaufen, wo sie es bekommen können.
In diesem Amte befinden sich 3 Papiermühlen, nämlich zur Petershütte, in Förste und in Dorste, welche gutes Druck= und Schreibpapier in verschiedenen Sorten liefern. Die älteste von djesen Papiermühlen ist die zur Petershütte, jetzt ein Eigenthum der Herren Gebrüder Andrä. Sie ist 1586, zur Zeit des Herzogs Wolfgang, neu angelegt und 1764 von Grund auf neu gebaut worden.
An der Spitze des königlichen Amtes Osterode steht gegenwärtig (1832) der Herr Oberamtmann und Guelfenritter, Joh. Fr. Kern, und außerdem sind dabei die Herren Assessoren G. Fr. K. von Pufendorf, E. Stölting und B. K. G. Baurschmidt, angestellt. — Der Hausvogt (jetzt Herr J. Fr. Rehren) hat seinen Wohnsitz auf der Freiheit.
Sachverständige, unbefangene Beobachter behaupten, daß im Allgemeinen der Landmann im Amte Osterode seinen Acker mit großer Einsicht und Sorgfalt baue, und zur fleißigen Betreibung des nützlichen Obstbaues, welcher ohne Vernachlässigung des Ackerbaues gar wol bestehen kann, seit einiger Zeit ein recht lobenswerther Trieb bemerkt werde. In Förste ist unter Anordnung und thätiger Mitwirkung des Herrn Amtsassessors Stölting eine schöne Baumschule angelegt worden. Seit einigen Jahren fängt man hier an, zur Bestellung des Ackerbaues auch Kühe zu gebrauchen (was nach der Versicherung Sachverständiger alle Nachahmung verdient); im Allgemeinen jedoch und besonders bei größeren Ökonomen wird die Ackerbestellung mit Pferden betrieben. Tabaksbau findet hier gar nicht statt; die Schaf= und Hornviehzucht ist nicht unwichtig; für Pferdezucht geschieht noch zu wenig; Schweine werden nur zum eigenen Bedarf, nicht, aber zum Verkauf, aufgezogen. Den Flachsbau treibt man. nur so stark, daß er den Aussaat hält man hier den von der Ostsee kommenden Leinsaamen für viel besser, als den einheimischen. Die Garnspinnerei ist hier nicht unbedeutend, und wenn der Landbau ruhet, wird der Weberstuhl in vielen Häusern in Bewegung gesetzt.
Nach der am 1. Julius 1833 stattgefundenen allgemeinen Wohnhäuser- und Volkszählung im Königreiche Hannover, hat es sich ergeben, daß das königliche Amt Osterode *) aus 946 Feuerstellen und 6,374 Seelen bestehet. Davon kommen auf das Pfarrdorf Dorste 171 Feuerstellen und 1143 Seelen; auf das Pfarrdorf Eisdorf 110 Feuerstellen und 811 Seelen; auf das Kirchdorf Förste 197 Feuerstellen und 1207 Seelen, worunter 36 Israeliten; auf das Pfarrdorf Nienstedt 41 Feuerstellen und 261 Seelen; aus Petershütte 28 Feuerstellen und 209 Seelen; auf Katzenstein 27 Feuerstellen und 171 Seelen; auf Laßfelde 65 Feuerstellen und 392 Seelen; auf das Pfarrdorf Schwiegershausen 163 Feuerstellen und 926 Seelen; auf die Freiheit (und was zu ihr um die Stadt gehört) 144 Feuerstellen und 1254 Seelen.
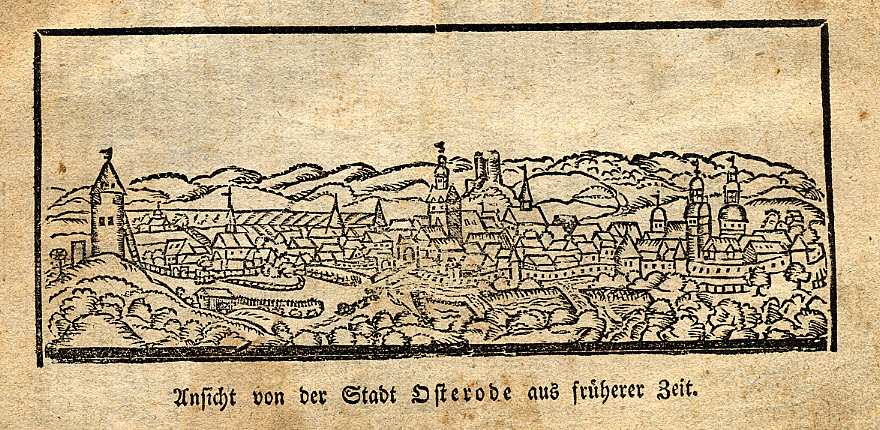
1830 begann für Osterode das Maschinenzeitalter
Osteroder Kreisanzeiger 26.05.1982
Ein Bäckergeselle baute Spinnmaschine - Erste elektrische Beleuchtung in der Freiheit
OSTERODE. Daß in Osterode ausgerechnet mit der Erfindung eines Bäckergesellen 1830 das Maschinenzeitalter eingeleitet wurde, berichten neuere Akten im Stadtarchiv. Der sonst nirgendwo genannte einfache Bäckergeselle Schöttler bastelte auf dem »Rotenhaus« in Osterode, einem damals bekannten Gasthof und Ausflugslokal, das allenthalben in der Stadt sehr bekannt war, 1830 als »hobby« eine Spinnmaschine für die Osteroder Tuch- und Spinnbetriebe und stellte sie dort auch auf.
Seine Versuche waren so erfolgreich, daß die Wollwarenfabrik Greve von ihm die Maschine übernahm. Für diese Spinn- und andere Maschinen bestanden 1895 in Osterode bereits drei Maschinenwerkstätten. Man war insbesondere in der Freiheit, der damaligen Nachbargemeinde und dem heutigen Ortsteil, auf dem Gebiete des Maschinenbaues sehr tätig. Die einschlägigen Handbücher der damaligen Zeit vermerken dort mehrere Eisen- und Maschinenbetriebe. In der Fabrik Allwörden-Badendieck wurde 1888 erstmals eine voll elektrische Beleuchtung in Betrieb genommen. Sie besaß eigene Aggregate. Die Stadt seihst erhielt erst 1907/08 Anschluß an das Elektrizitätsnetz. In Eisdorf versorgte 1910 das »Elektrizitätswerk Eisdorf GmbH« einige Ortschaften mit Strom. Hier stand als Energiequelle zunächst aber nur die Wasserkraft der Söse zur Verfügung. Am Stadtrand von Osterode ist dann ein größeres Werk mit Heißdampflokomobilen mit zusammen 2000 PS errichtet worden. Es erhielt den Namen »Licht- und Kraftwerke Osterode«. Da das Osteroder Werk mit seinem Leistungsaufkommen zu klein war, wurde es 1925 über das Umspannwerk Münchehof an das Hochnetz der hannoverschen Großkraftwerke angeschlossen. Interessant ist, daß nach Berichten der Osteroder Kreisausschusses noch 1907 im Kreis Osterode 146 Dampfmaschinen gezählt wurden. Sie unterstanden hinsichtlich ihrer Überwachung und ständigen Überprüfung dem »Hannoverschen-Dampfkessel-Überwachungsverein«. Nur der Kreisausschuß in Osterode durfte die Genehmigung zur Aufstellung von Dampfmaschinen erteilen.
Auch für Osterode und' die Tuchfabriken am Ort war die Anschaffung mechanischer Spinnmaschinen 1830 sicher eine große Errungenschaft. Sie standen zuerst bei Greve und Piderit und besaßen je zwanzig Spindeln, die zuerst noch mit Menschenkraft und durch die Gefalle der Söse und des Mühlengrabens angetrieben würden. Die heutige Abgunst und der in der Nähe dort abgeleitete Mühlengraben (von der Bezeichnung Abzucht wie in Goslar) war «in bevorzugtes industrielles Quartier.
Fragt man um diese Zeit nach dem Stand der Wollzeugfabriken in der Stadt, so hatte diese 1831 noch immer 125 »Spinnstühle« in Betrieb, die über 500 Arbeiter beschäftigten.
Das Hauptabsatzgebiet für die Osteroder Fabrikate war Norddeutschland, da bei den hohen Zöllen eine Einfuhr in das benachbarte Preußen kaum möglich war. Statistische Berichte, die u. a. auch an die Regierung in Hildesheim, die damalige Landdrostei, gingen, zählen um diese Zeit folgende Tuchfabriken in Osterode auf: Gebrüder Dameral, Graseler und König, Greve und Um, Ludolf Greve, Wilhelm Greve d. A., Johann Friedrich Struve, Wilhelm Struve.
Der Anschluß an das Eisenbahnnetz, vor allem an die Nord-Süd-Strecke, ist stets ein besonderes Anliegen der Stadt und ihrer Fabrikbetriebe gewesen. Übrigens hatte noch in den 60er Jahren des Vorigen Jahrhunderts die Stadt eine eigene Handelskammer. Es ist aber nie gelungen, eine Eisenbahnverbindung in den Oberharz über Osterode zu verwirklichen. Zwei Weltkriege haben das Projekt vereitelt; Die Osteroder kreiseigene Bahn nach Kreiensen über das Alte Amt Westerhof könnte wenigstens einen gewissen Ausgleich bringen und einen Anschluß nach Kreiensen verwirklichen. Es war die Braunkohlengrube Ernst zu Düderode, die die erste Anregung zur Schaffung einer Kreisbahn gab. Das war 1889. Aber die staatlichen Stellen lehnten damals ab. Erst am 19.12.1890 fand dann eine entscheidende Sitzung statt, die im Kreistag den Bau einer Kreisbahn befürwortete. Die Schlußstrecke der inzwischen gänzlich still gelegten Kreisbahn wurde am 1. Mai 1901 eingeweiht. Heute muß man es im Interesse des Fremdenverkehrs sehr bedauern, daß nicht wenigstens die alten Dampfloks und Waggons für eine auch anderenorts beliebte »Fahrt in die alte Zeit« gerettet wurden.
(Stadtarchiv und Kreisarchiv Osterode) Dr. Martin Granzin
Zusatz (aus dem Archiv-Vegelahn) eine Ansichtskarte von 1902:
